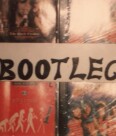Instrumente der Welt
Mit den trockenen, sperrigen Tönen der Ngoni begleiten sich die malischen Jeli (Griots) seit Jahrhunderten. Noch immer ist Banzumana Sissoko (1890-1987), der blinde Griot, der die Nationalhymne Malis komponiert hat, eine Legende in dem westafrikanischen Land. Wenn der „alte Löwe“ im Radio seine Stimme erhob, lauschte ganz Mali: Er war eine moralische Institution. Bassekou Kouyaté, der Innovator der Ngoni, ist Sissokos Enkel. Er sagt: „Die Bamana-Tradition von Ségou war es, aus der der Blues kam. Also erforschen wir auch die enge Verbindung zwischen dem amerikanischen Blues und der Segu-Musik.“
Ngoni
Der Blues Westafrikas
(2014)
Von Hans-Jürgen Schaal
Dank der jahrhundertealten Tradition der Griots gibt es in Westafrika eine Vielfalt von Saiteninstrumenten: Lauten, Harfen, Zithern, Fiedeln in zahlreichen Varianten, auch Mischformen wie Streichlauten oder Lautenharfen. Da die Instrumente bei den verschiedenen Stämmen zudem verschiedene Namen tragen, ist für Verwirrung reichlich gesorgt. Festzustehen scheint aber: Das Ur-Instrument der malischen Griots ist die Stiel- oder Spießlaute, in den Mande-Sprachen „Ngoni“ genannt. Sie ist für Mali seit dem 14. Jahrhundert verbürgt, findet sich aber ganz ähnlich bereits auf altägyptischen Abbildungen (ca. 1500 v.Chr.). Vom Nil aus hat die Spießlaute früh schon den Sudan, den Maghreb und Westafrika erreicht. Ein- bis siebensaitige Varianten der Ngoni heißen in Nordafrika Gimbri, Sintir oder Tahardent, im Westen Xalam, Gambare, Kontingo, Akonting, Molo oder Garaya. Um die Verwirrung komplett zu machen: Der Name „Ngoni“ wird auch für einige Lautenharfen benutzt, die aus der Spießlaute entwickelt wurden, etwa die „Donso Ngoni“ (Jägerharfe) oder die erst Mitte des 20. Jahrhunderts entstandene „Kamale Ngoni“ (Jünglingsharfe), beide sechssaitig.
Die eigentliche Ngoni hat traditionell nur drei bis vier Saiten und ist etwa 60 Zentimeter lang. Das Instrument wird vom Spieler wie eine europäische Laute oder Gitarre um den Hals gehängt, mit einer Hand gezupft und mit der anderen am Stab gegriffen. Der Korpus ist meist schmal und länglich, ein kanuförmig ausgehöhlter Holzblock, seltener halbkugelförmig (aus einer Kalebasse). Als Resonanzdecke dient eine gespannte Tierhaut von der Kuh oder Ziege, die dem Instrument zusätzliche Trommelqualitäten verleiht. Der Hals, ein runder Stab, ist in den Korpus eingeführt, die Saiten daran, meist pentatonisch gestimmt, werden mit Lederriemen befestigt. Eine Art Plektrum am Daumen kann den gezupften Saitenton verstärken.
Aus der Ngoni haben sich nicht nur die Stegharfen und andere afrikanische Saiteninstrumente entwickelt. Auch das afroamerikanische Banjo geht auf sie zurück, obwohl eine direkte Herleitung des Wortes „Banjo“ von „ba ngoni“ (große Ngoni) nicht nachzuweisen ist. Doch wer die stolpernden, sperrig verzwirbelten, dumpf-perkussiven Läufe der Ngoni-Spieler hört, fühlt sich fast sofort an den afroamerikanischen Folk Blues erinnert, an die wildwüchsigen Banjo- und Gitarrentöne vom Mississippi. Direkt von der Ngoni beeinflusst war auch Ali Farka Touré, der malische Gitarrist und „König des Wüsten-Blues“.
Der heute bekannteste Ngoni-Spieler weltweit ist Bassekou Kouyaté aus der malischen Region Ségou. Er entstammt zwei traditionsreichen Clans von Griots und Ngoni-Spielern und ist der konsequenteste Innovator seines Instruments. Kouyaté bevorzugt eine kleinere, höher gestimmte Ngoni, die er mit sieben Saiten bespannt hat. In seiner Formation „Ngoni ba“ kombiniert er aber gleich vier Ngonis verschiedener Tonlagen als Ensemble – eine völlig neue Definition des Instruments, das über Jahrhunderte weitgehend nur der Begleitung des Griot-Gesangs gedient hat. „Ja, das ist ein brandneuer Stil“, bestätigt Kouyaté. „Nachdem ich ganze Orchester von Gitarren und anderen Instrumenten gesehen hatte, dachte ich: Warum nicht auch ein Ngoni-Ensemble? Es ist ein sehr vielseitiges Instrument mit Tausenden von Möglichkeiten. Du kannst damit den Sound der Gitarre oder der Kora imitieren oder es anders als beide klingen lassen.“
Kouyaté belegt in seiner Musik immer wieder die Nähe der Ngoni zur Bluesgitarre. Er ist offen für westliche Einflüsse, arbeitet mit elektrischer Verstärkung, Wah-Wah-Pedal und Rock-Elementen. „Ich will mich in der Griot-Kultur bewegen, in ihr aber neue Wege ausloten“, sagt Kouyaté. Auch mit dem afroamerikanischen Bluesmusiker Taj Mahal arbeitete er zusammen, den er bei einem Banjo-Festival in Tennessee kennengelernt hatte. Für Taj Mahal war Kouyaté der lebende Beweis dafür, dass der Blues in der Gegend von Ségou seinen Ursprung hat.
© 2014, 2021 Hans-Jürgen Schaal
© 2014 Hans-Jürgen Schaal |